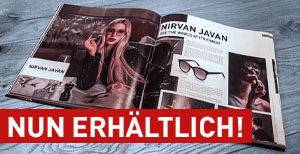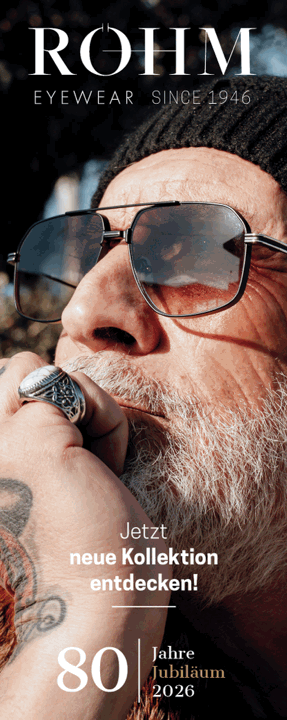Berliner Begegnung 2025: Pro Retina im Dialog

Unter dem Motto „AI Catcher: KI-Revolution im Gesundheitswesen“ fand am 23. Oktober 2025 die vierte Berliner Begegnung in der Kaiserin-Friedrich-Stiftung in Berlin statt.
Sie steht in der langjährigen Tradition der Reihe „Pro Retina im Dialog“. Experten aus Forschung, Medizin und der Patientenorganisation diskutierten gemeinsam mit Betroffenen über Chancen, Risiken und Perspektiven des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Augenheilkunde – insbesondere im Hinblick auf seltene, erblich bedingte Netzhauterkrankungen.
Die hybride Veranstaltung beleuchtete, wie der Einsatz von KI Diagnostik, Therapie und Alltagsunterstützung von Menschen mit Sehverlust verbessern kann – und welche politischen, ethischen und praktischen Rahmenbedingungen es dafür braucht. „KI ist ein echter Gamechanger, auch in der Versorgung der Betroffenen“, betonte Dario Madani, Geschäftsführer Pro Retina Deutschland e. V. in seiner Begrüßung. Dr. Frank Brunsmann, Fachbereichsleiter Diagnose und Therapie, forderte, dass sich Forschungsprogramme und Projekte mehr am Bedarf und Nutzen für Betroffene orientieren und diese in den Forschungsprozessen auch stärker beteiligen: „Die Stimme der Patienten wird noch zu wenig gehört. Forschung darf kein Selbstzweck sein.“ Dr. Bettina von Livonius (LMU München) stellte die Möglichkeiten und Grenzen von KI-gestützten Hilfen für Mobilität, Alltag, Unterricht und Beruf dar, Prof. Dr. Peter Krawitz (Universität Bonn) und Dr. David Merle (University College London) stellten aktuelle Forschungsergebnisse zur KI-basierten Diagnostik vor und zeigten, wie datengetriebene Systeme ärztliche Entscheidungen ergänzen, aber nicht ersetzen können.
Eindringlich warnte insbesondere David Merle in seinem Vortrag vor menschlichem Kompetenzverlust. Peter Krawitz machte deutlich, dass vor allem bei seltenen Erkrankungen die internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf Daten wichtig, Deutschland hier aber mit seinen Rahmenbedingungen nicht konkurrenzfähig sei und aus diesem Grunde bei internationalen Kooperationen häufig nicht mithalten könne.